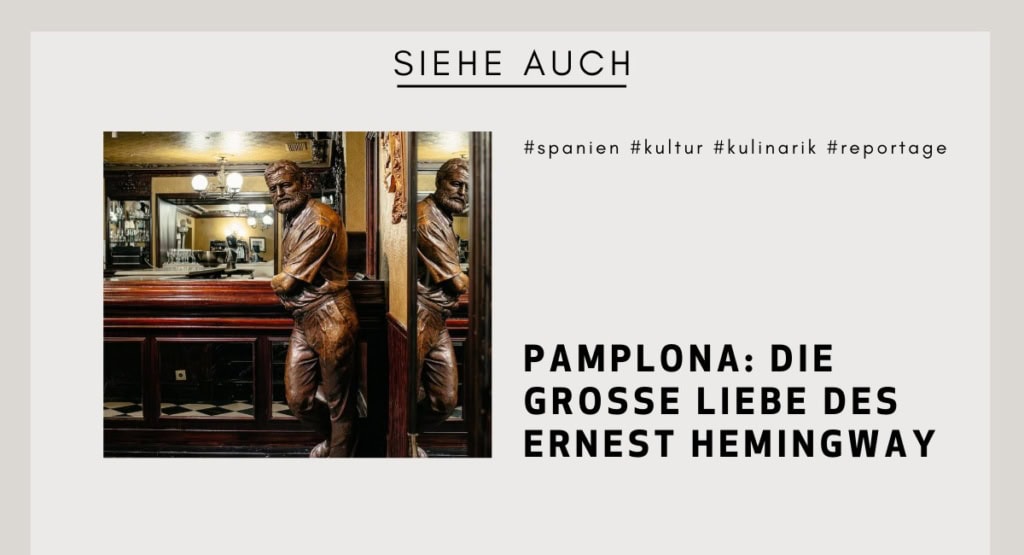Essen, trinken, essen, trinken, schlafen. Dann wieder von vorn. Wer ins Baskenland reist, braucht Durchhaltevermögen, wird aber belohnt mit wunderbaren Menschen und einer bunten Kultur, auf die die Basken stolz sind und die hier in jeglicher Facette gelebt wird.
Text: Andreas Dauerer
Am Anfang war Gilda. Und dann kam lange nichts.
Anschließend sehr wahrscheinlich ein saures Gesicht und ein beherzter Griff zum Txakoli, um ebendiesen wieder wegzuspülen. Der Rest ist Genuss. So oder so ähnlich muss es sich zugetragen haben, als man die erste Pintxo in San Sebastian mehr oder weniger zufällig erfunden hat.
Gilda, Pintxo, Txakoli – drei Dinge, ohne die der Baske auch heute nicht leben kann.

Andreas Dauerer
Pintxo, oder spanisch »Pincho«, heißt das Stäbchen, und damit werden ganz allgemein die tapasähnlichen Köstlichkeiten genannt, da viele mit dem Holzstäbchen aufgespießt und am Tresen angeboten werden. So ist das auch mit Gilda, quasi der Urmutter der Pintxos, bestehend aus Anchovis, einer bis zwei Oliven und zwei bis drei Guindillas, einer Pepperoniart aus dem Baskenland, eingelegt in Essig. Verde, picante y salado – grün, pikant und salzig, womit wir beim Namen werden.
Ein Hauch Hollywood
Denn mit Gilda ist Rita Hayworth aus dem gleichnamigen Film gemeint, der im Nachkriegsspanien sogar zensiert wurde. Der Grund? Im Film singt und tanzt eine verführerische Rita Hayworth und vollführt einen, Achtung, Handschuhstriptease. Für die Spanier war sie da längst zum Sexsymbol geworden, und mit verde, picante y salado kann man auch andere schöne Dinge verbinden, also außerhalb der Gilda mit ihrem Holzstäbchen. Zu guter Letzt noch der Txakoli, der trockene Weißwein aus der Region, der aber mitunter schon mal einem schweren Rioja weichen muss. Soweit zum Diskurs der Pintxo Gilda. Lässt man die Gilda weg, dann ist Pintxo noch viel, viel mehr.
Miteinander sein, genießen, gemeinsam Zeit verbringen, sich unterhalten, leben.
»Zum Pintxos-Essen geht man nicht allein, das macht man mit Freunden«, erzählt Koch Gorka Leal. »Da bleibt man dann ein, zwei Stunden, und anschließend geht man nach Hause und isst mit der Familie.« Quasi eine kulturelle Versumpfschranke, und Schnauzbart Leal muss es wissen, er ist schließlich Koch und hier geboren. Wohl dem, der keine Familie hat. Denn man kann ganz vortrefflich zwischen Bilbao und San Sebastian quasi in jedem kleinen Ort von Bar zu Bar hüpfen und sich sehr wohl den verschiedensten, zum Teil extrem aufwendig gemachten Pintxos hingeben. Nach der dritten Bar hat man dann nämlich keinen Hunger mehr und fängt an, vor allem Txakolí oder Rioja zu genießen. »Einheimische machen das jedoch eher selten«, erzählt Leal, der neben dem Koch-Sein zu einer der ältesten »Txokos«, der Sociedad Unión Artesana, in der Stadt gehört.
Der Club der Geniesser
Früher waren diese Sociedades ein Treffpunkt für die Männer. Zu Hause hatte selbst der hartgesottenste Seebär eben nicht die Hosen an, sondern seine Frau, so ein Erklärungsversuch. Um also von zu Hause Abstand zu haben und sich die Zeit sinnvoll zu vertreiben, schlossen sich die Männer in Vereinen mit ihresgleichen zusammen. Dort kochten, tranken und sangen sie. Heute funktioniert der Verein noch wie damals. Man wird Mitglied, kocht, isst, trinkt, singt und teilt all das mit den Mitgliedern. Gemeinschaftlich.
Frauen haben mittlerweile auch in vielen Txokos ein Zugangsrecht, einige konservative dulden jedoch noch immer nur Männer. Besucher müssen etwas Glück oder gute Beziehung haben, um einen Abend dort miterleben zu dürfen. Herumfragen lohnt sich, denn viele Sociedades weichen immerhin ein klein wenig ihre Regelungen auf, sodass Mitglieder auch Freunde oder ihre Familien mitbringen dürfen. Wer es also schafft, wird nebst gutem Essen mit einem tiefen Einblick in die baskische Seele belohnt.
Wein? Unbedingt!
Dieser Seele kann man sich natürlich auch außerhalb der Sociedades anzunähern versuchen. In erster Linie natürlich über das Essen. Das sollte man sogar. Unbedingt dabei aber das Trinken nicht vergessen, denn schließlich liegt, die Basken sagen die bessere, Hälfte des Rioja-Gebietes auf baskischem Territorium. Laguardia etwa, eine malerische Kleinstadt auf dem Hügel mitten in der Rioja-Alavesa-Region. Hier hängt fast alles und jeder am Weintropf, und mich beschleicht das Gefühl, dass eigentlich alle Bewohner in irgendeiner Form für mindestens ein Weingut tätig sind.

Andreas Dauerer
Mikael von der Bodega Casa Primicia führt mich durch den ältesten Weinkeller der Stadt. Ein bisschen fühle ich mich wie Sean Connery als William von Baskerville in Humberto Ecos »Im Namen der Rose«, als wir die steilen, in den Berg gehauenen Stufen hinuntergehen. »Der Berg hat eine ideale Temperatur zur Lagerung der Weine«, erzählt Mikael, und das ist schließlich das Wichtigste. »Wenn es brennt?«, frage ich. »Dann sollte man schnell raus«, lacht Mikael und zeigt auf eine winzige Luke. »Das gab es alles schon, es gibt seit jeher auch Schächte direkt nach draußen.« Richtig dick sollte man dafür nicht sein, denke ich bei mir. Betrunken besser auch nicht. Da trifft es sich gut, dass wir die anschließende Verkostung auf dem gegenüberliegenden Weinberg machen, inklusive unverstelltem Blick auf Laguardia.
Der Begriff »Rioja« ist streng geschützt, und eigentlich muss man sich nur die vier Etiketten der Casa Primicia einprägen, um ein wenig mitreden zu können: T, Gn, M, Gr. Das nämlich sind die Abkürzungen der hier angebauten Reben für den Roten: Tempranillo, Garnacha, Mazuelo und Graciano. Ausnahmen gibt es jedoch. Die Casa Primicia etwa hatte schon vor der strengen Rioja-Regulierung andere Rebsorten auf ihren Feldern angebaut, welche sie weiterhin verwenden darf. »Aber das machen wir mit sehr viel Augenmaß«, lacht Mikael, und ich, Marketing hin oder her, glaube ihm das sogar.
Käse – ja, das können sie auch
Ich fühle mich richtig gut aufgehoben im Baskenland.Man isst und trinkt gerne und viel, und wenn man es mal nicht tut, dann spricht man noch viel lieber darüber. Und wenn auch das mal nicht so sein sollte, dann arbeitet man nicht selten daran, etwas Gutes herzustellen. Käse etwa, oder genauer, den Idiazábal, einen Schafskäse, der in den Regionen Gipuzkoa und Navarra produziert wird. Da nur das Beste gut genug ist, gehe ich zu Eneko Ondarre im Örtchen Segura, knapp fünf Kilometer vom namensgebenden Epizentrum des Käses, Idiazábal, entfernt.
Eneko gewann nämlich 2014 den jährlich stattfindenden Wettbewerb des besten Idiazábal in Ordizia. Die eine Hälfte wird dabei von den Juroren verkonsumiert, die andere kommt für einen guten Zweck unter den Hammer. Dabei erzielte das halbe Kilo Schafskäse einen Preis von 13.050 Euro. Rekord. »Kurz danach gab es schon ein paar mehr Angebote«, erzählt Eneko unaufgeregt. »Aber ich habe alles abgelehnt.« Schließlich müsse er ja auch noch leben und für seine Familie da sein und nicht nur arbeiten. Eine sehr gesunde Einstellung, wenngleich in dieser ökonomisierten Zeit selten.

Andreas Dauerer
Viele Schafe machen einen Käse
Für den Idiazábal dürfen nur die Rassen Latxa und Carranzana verwendet werden, von denen die »Quesería Ondarre« etwas 120 Schafe hat, die auf den umliegenden grünen Hängen grasen. Daraus entstehen dann pro Jahr 1.300 Kilo Käse. »Ich verkaufe ausschließlich direkt hier von der Produktion oder bei meinem Bruder im Ladengeschäft.« Natürlich nimmt er ausgesuchte Vorbestellungen von Freunden und Bekannten an, ansonsten jedoch muss man in Segura vorbeikommen und das nehmen, was da ist. Aber das reicht beileibe auch aus. In der Stube darf ich den Idiazábal endlich probieren. Mindestens 90 Tage muss er im kühlen Reiferegal gelegen haben, ehe er verkauft wird. Unterschieden wird er dann lediglich dahin gehend, ob er mehr oder weniger Würze hat oder noch zusätzlich geräuchert worden ist.
Alle vier Sorten, die angeschnitten werden, sind ausnahmslos hervorragend und werden standesgemäß von einem Gläschen Txakolí begleitet. Sein Geheimnis? Eneko schüttelt nur den Kopf. »Es gibt keines, das kann theoretisch jeder machen.« Die Qualität der Käselaibe hänge aber damit zusammen, was die Schafe so gefressen hätten. Die Wiesen in der Region Gipuzkoa scheinen demnach über eine gehörige Portion Käsemagie zu verfügen. Ich komme jedenfalls nicht umhin, mir ein knappes Kilo zu kaufen. Gefasst bin ich auf alles, nur nicht, dass ich unter 20 Euro bleibe. Gut leben – ein weiterer Grundsatz der Basken, soll hier kein Luxus sein, sondern in der Tat jeder können.
Ein Sternenhimmel an Restaurants
Deshalb verwundert mich auch nicht, dass es nirgendwo sonst so viele Restaurants mit Stern und Sternen auf einem Fleck gibt wie bei den Basken. Trotz dieser höchsten Michelin-Sterne-Kochdichte geht es vollkommen unprätentiös in deren Restaurants zu. Man macht sich also vor allem Gedanken um das Essen, die Gesellschaft und den Wein und nicht, was man für einen dortigen Besuch anzuziehen hat. Ich finde das vernünftig und kann mich bei Fernando Canales selbst überzeugen.
Das Etxanobe in Bilbao ist mit einem Stern dekoriert und etwas unscheinbar im Palacio Euskalduna Jauregia, einem Bürogebäude, untergebracht. Man besteigt den kleinen Glaslift mit Blick auf den Ría de Bilbao, und dann können die Gaumenfreuden schon beginnen. Fernando stellt sich dabei als überaus geistreicher wie sympathischer Chef heraus. Bei jedem Gang kommt er kurz zu seinen Gästen an den Tisch und erklärt das Zusammenspiel seiner Gerichte, manchmal sogar inklusive einem launigen Exkurs in die Rioja-Region, der fast so spannend ist wie seine moderne und innovative Küche. Wohlgesättigt, zufrieden und glücklich sitze ich also vor dem Dessert »Choccolate picante« und spüre ein leichtes Kribbeln auf der Zunge.

Andreas Dauerer
Auch architektonisch nennenswert
Natürlich muss man in Bilbao das wunderbare Guggenheim Museum von Stararchitekt Frank Gehry besuchen. Es hat mit seiner Eröffnung 1997 einen wahren Besucherstrom in Bilbao ausgelöst. Zudem wurde es samt der übergroßen bunten Welpenskulptur von Jeff Koons zur Ikone der Stadt wurde. Die hübsche Altstadt erläuft man sich zu Fuß, immer wieder tauchen auf dem Weg dorthin die glasbedachten, leicht futuristischen Eingänge zur Metro auf, für die Sir Norman Foster verantwortlich ist.
Die gotische Kathedrale für den Heiligen Jakob ist einen Besuch wert. Und, natürlich, auch der Mercado de la Ribera direkt am Fluss. Nicht etwa, weil der Markt besonders ungewöhnlich wäre. Im Gegenteil. Er ist neu gestaltet und versprüht daher eher spröden Charme. Aber man bekommt auf engstem Raum alles, was man für den kleinen Hunger braucht. Fällt der nach dem Stadtbummel größer aus, kann man sich seine Einkäufe im darunter liegenden Restaurant La Ribera direkt zubereiten lassen. Ein ziemlich interessanter Ansatz, der jedoch gut angenommen wird, und natürlich kann man auch á la carte essen. Wobei wir hier schon wieder beim Thema sind.
Letztlich weiß ich nicht, ob es an Gilda liegt, liebes Baskenland, oder doch, weil die Liebe durch den Magen geht. Du aber hast wie ganz selbstverständlich einen festen Platz in meinem Herz erobert.